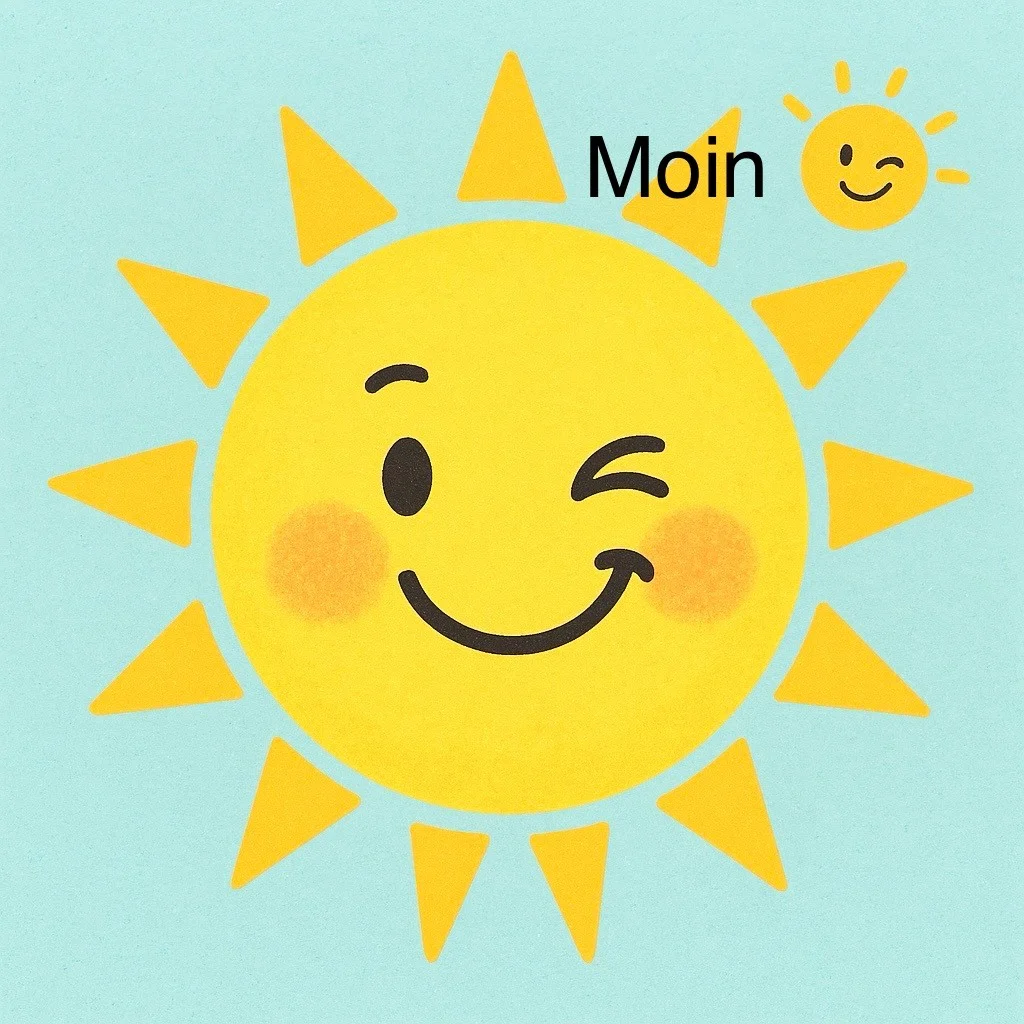Jedes Jahr im Frühjahr passiert es wieder: Die Uhr wird vorgestellt, die Sonne lacht früher und unser Körper fragt sich, was das alles soll. Denn während der Wecker uns sagt, dass es jetzt eine Stunde früher ist, interessiert das unsere Biochemie herzlich wenig.
Der Star des Dramas?
Melatonin, das Schlafhormon. Produziert in der Zirbeldrüse, steuert es unseren Tag-Nacht-Rhythmus und wird normalerweise von der Dunkelheit aktiviert. Aber plötzlich ist es abends länger hell. Unser Körper denkt: „Zeit zum Wachbleiben!“ Das Einschlafen fällt schwerer, und morgens ist die Müdigkeit quasi chemisch vorprogrammiert.
Gleichzeitig schaltet unser Körper auch den Cortisol-Haushalt um. Normalerweise steigt das Stresshormon morgens an, um uns fit für den Tag zu machen. Doch nach der Zeitumstellung hinkt die Ausschüttung hinterher. Das erklärt das kollektive Gähnen in der ersten Woche nach der Umstellung.
Und als wäre das nicht genug:
Unser Serotoninspiegel, das “Glückshormon”, leidet ebenfalls kurzzeitig unter der Umstellung. Denn er ist eng mit Melatonin verbunden. Wenn der Rhythmus durcheinander kommt, brauchen auch Stimmung und Energie ein paar Tage zur Anpassung.
Aber keine Sorge:
Ein bisschen Sonnenlicht am Morgen (sofern sie nicht verschlafen wird), Bewegung und Geduld helfen, die innere Uhr neu zu justieren. Bis dahin gilt:
Kaffee ist (biochemisch gesehen) unser bester Freund.